Jahresmitgliederversammlung des BUND Schmitten
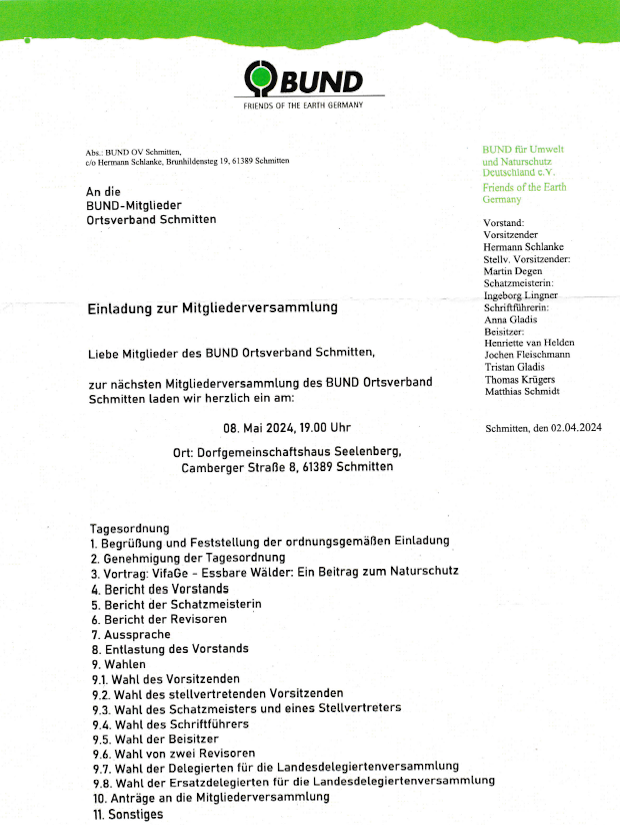 Einladung und Inhalte unserer Jahresmitgliederversammlung 2024
(BUND Schmitten)
Einladung und Inhalte unserer Jahresmitgliederversammlung 2024
(BUND Schmitten)
Am 08. Mai 2024 findet um 19:00Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Seelenberg unsere jährliche Mitgliederversammlung statt.
Zu Beginn konnten wir die Gartenspezialistin Dr. Anna Maria Holl für einen inspirierenden Vortrag gewinnen. Sie berichtet, wie in unserer direkten Nachbarschaft ein "essbarer Ort" entsteht und wie sie und ihr Verein "Vielfalt Genießen e.V." das machen.
Sie beantwortet Fragen und gibt Tipps zur Nachahmung, auch hinsichtlich Zusammenarbeit mit öffentlichen Stellen und Förderern. Der Vortrag ist kostenlos, eine Spende willkommen.
Im Anschluss findet unsere Mitgliederversammlung 2024 statt.
Mitglieder, interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Förderer sind sowohl zum Vortrag als auch zur JMV herzlich willkommen.
Ein paar Formalien müssen leider sein, da wir gemeinnützig sind.
Aber wir machen es uns gemütlich und es gibt interessante Themen zu besprechen wie eine Saatgut- und Pfanzenbörse.
Das Dorfgameinschaftshaus Seelenberg liegt in der Camberger Straße 8 in 61389 Schmitten-Seelenberg.
Erfolgreiche Mitmach-Aktion zur Heckenpflege am Kohlberg am 27. Januar
 Aktion am Kohlberg, Januar 2024
(Fotos: Martin Degen)
Aktion am Kohlberg, Januar 2024
(Fotos: Martin Degen)
Anbei einige Eindrücke der Mitmachaktion zur Heckenpflege am Kohlberg, die ein voller Erfolg war.
Um 10:00 Uhr versammelten sich die Teilnehmer und Frau Dr. Kilian führte mit anschaulichen Bildern, Skizzen und Beispielen in das Thema ein.
Um 11:00 ging es mit den Schnittmaßnahmen dann los.
Es wurde ein 90m langer Heckenstreifen in ca. 10m-Abschnitte und abwechselnd in Sektionen A,B,C aufgeteilt.
Für dieses Jahr wurden die drei A-Sektionen beschnitten und mit regionalem Saatgut und Setzlingen vorbereitet.
Der Rest bleibt stehen und kommt im nächsten bzw. übernächsten Jahr an die Reihe.
Eine Sektion ist fast fertig, aufbereitet mit Käferkeller, Igel-Tipi und Totholzstämmen, die noch zu Wildbienen-Hotels aufgebohrt werden.
(Das ist übrigens noch eine Aktion, die für am Sonntag 28. Januar mit tatkräftiger Unterstützung einiger Kinder stattfand.)
Dank der zahlreichen Helfer kamen wir in zwei Stunden schon sehr weit, sodass von 13:00-14:00 Uhr noch die leckeren Suppen und der Kuchen genossen werden konnte.
Ganz herzlichen Dank an alle Helfer und an der Orga beteiligten!
Und ganz besonders möchten wir uns bedanken bei:
- Frau Dr. Simone Kilian für den hervoragenden Vortrag,
- Iris Sachs, die uns auf dem Pyrolysekocher eine leckere Kartoffelsuppe gekocht hat,
- Heike Degen für die ebenso leckere Kürbissuppe,
- Andreas Kratz, bei und mit dem wir die Aktion überhaupt erst durchführen konnten,
... und natürlich bei unserer Bürgermeisterin, Julia Krügers, die sich extra Zeit genommen hat, uns zu besuchen!
Bis zur nächsten Aktion. Bei Interesse gerne melden an martin.degen(at)bund-hochtaunus.de und auch weitersagen...
Waldzustand Hochtaunus

Gemeinsam mit Revierförster Axel Dreetz haben wir uns ein Bild vom Zustand des Waldes um Schmitten gemacht. Von besonderer Bedeutung ist hier der Schädlingsbefall, der nun sowohl auch 160-180 Jahre alte Buchen betrifft. Da in einigen Bereichen inzwischen etwa die Hälfte des Altbestandes betroffen ist, und nun auch Gefahr für Wanderer durch abfallende Äste besteht, ist massive Flächenrodung notwendig. Hiermit soll die Ausbreitung der Borkenkäfer verhindert werden.
Im Taunus werden vorrangig Bereiche gerodet, die vom Borkenkäfer befallen sind. Da die einzelne Untersuchung der Bäume sehr zeitintensiv ist, werden die Förster bei deutlich erkennbaren Trockenschäden durch die Forstwirte und Maschinenführer unterstützt. Diese Rodungen werden durch Unternehmen durchgeführt und von Hessen-Forst überwacht. Da die Flächen schnell wieder zuwachsen, ist das Wild langfristig kaum betroffen, und Trockenholzbäume werden bewusst für z.B. Spechte und Fledermäuse stehengelassen.
Hoffnung liegt im Umbau des Waldes auf mehr Mischwald mit klimaresistenteren Baumarten, der schon einige Jahre im Gange ist. Dies ist auch für Holzernte-Unternehmen wichtig, da der absterbende Wald hier insbesondere Sorgen um Arbeitsplätze bereitet.
Obwohl Initiativen zur Wiederaufforstung im Gange sind, besteht immer noch die Sorge, dass das Baumsterben weitergeht. Um dies zu verhindern, müssen jedoch die entsprechenden Daten vorliegen, damit die Faktenlage klar ist. Daher unsere Forderung an die lokale Politik: Es Bedarf einer intensiven Beobachtung, Analyse und transparenter Information über den Zustand des Waldes. Ein Vorbild für die lokale Ebene kann hier die Bundeswaldinventur vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sein. Insgesamt müssen die erforderliche Mittel für detaillierte Bestandsaufnahmen und Analysen bereitgestellt werden, damit dem Baumsterben entsprechen angegangen werden kann.